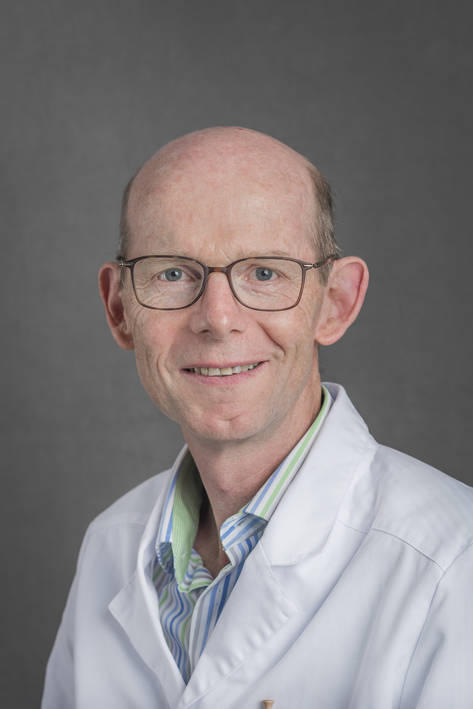Öffentliche Führung Onkologie
Mittwoch, 8. Januar, 17.30 bis 18.30 Uhr - Ohne Anmeldung

Wir wollen den Menschen dann zur Seite stehen, wenn sie uns und unsere medizinische Fachkompetenz brauchen. Ein Notfall tritt plötzlich auf, unerwartet und ungelegen. Rasches sowie richtiges Handeln ist dann gefragt – von allen Beteiligten.
Unser Notfall wurde in den vergangenen Jahren zunehmend aufgesucht – oft auch von Menschen, die keine Hausärztin oder keinen Hausarzt haben oder diese in jenem Moment nicht erreichen konnten. Für diese Menschen ist eine Aufnahme auf einen Notfall mit all seinen komplexen Abläufen oft gar nicht nötig und eher zeitraubend und umständlich. Um ihnen effizienter helfen zu können, haben wir neu einen Walk-in-Bereich, der integral zu unserem Notfall gehört und wo die Patientinnen und Patienten in der Regel direkt von einem erfahrenen Oberarzt oder einer Oberärztin gesehen werden. Das Wort „Walk-in“ beschreibt die Situation sehr deutlich: Man kann einfach reinlaufen – ohne einen Termin, ohne Voranmeldung oder vorheriges Telefonat.
Wenn Menschen mit einem akuten medizinischen Problem kommen, beurteilen wir die Dringlichkeit und den Umfang des Problems nach einem standardisierten System. Diejenigen, die den Notfall mit seinen Überwachungsmöglichkeiten brauchen, kommen sofort dorthin und werden auf der Notfallstation versorgt. Diejenigen, die ambulant ärztlich beurteilt und beraten werden können, bleiben im Walk-in.
Ein sehr erfahrener Kollege, Dr. med. Christoph Schulthess, der über viele Jahre bei uns in der Klinik tätig war, hat einmal den Satz geprägt: „Die Allgemeinmediziner sind die Spezialisten für das Ganze.“ Das hat mich sehr beeindruckt. Keine Notfalleinrichtung, und sei sie noch so gut, kann den eigenen Hausarzt oder die eigene Hausärztin ersetzen. Sie sind es, die den Patienten und die Patientin am besten kennen und zumeist über viele Jahre ein Vertrauensverhältnis aufgebaut haben. Darum ist uns die Zusammenarbeit mit den hausärztlichen Kolleginnen und Kollegen sehr wichtig. Ein enger Austausch ermöglicht es uns, in medizinischen Notfällen eine echte ganzheitliche Hilfe zu sein. In diesem Sinn wollen wir für die Betroffenen und die Kolleginnen und Kollegen da sein, denn auch die engagierteste Hausärztin und der eifrigste Hausarzt können nicht durchgehend für die eigenen Patientinnen und Patienten zur Verfügung stehen.
Frau Klein*, 80-jährig, kommt am frühen Morgen in den Walk-in. Sie ist sehr beunruhigt und erschöpft, denn sie hat eine „fürchterliche Nacht“ hinter sich, weil sie ständig auf die Toilette musste. Eine Urinuntersuchung genügt, um die Diagnose zu bestätigen, die die Patientin bereits selbst vermutet hat: eine Blasenentzündung. Die Patientin ist viel aufgebrachter, als was die verhältnismässig stabilen klinischen und Laborbefunde vermuten lassen. Auf die Frage, ob sie sich denn erkältet habe, erzählt sie, dass sie zwei Tage vorher ihren Kater spätabends draussen gesucht hat. Sie war in Panik, dass er wieder angefahren worden sei, hat einfach einen Mantel über ihren Pyjama geworfen und ist in die Januarnacht hinausgelaufen. Dabei ist ihr natürlich schon arg kalt gewesen.
Man mag diese Geschichte als ein unnützes Detail belächeln, aber sie ist es nicht. Denn es ist offensichtlich: der „kalte Schreck“ sitzt ihr noch fest in den Knochen.
Auch die Leitlinien raten bei einem nicht komplizierten Harnwegsinfekt, auf eine Antibiotikatherapie zu verzichten. Stattdessen fokussieren wir uns auf die Patientin und versuchen, sie so zu unterstützen, dass sie die Bakterien selbst überwinden kann. Dazu verwenden wir Tees, Eucalyptusauflagen und natürliche Medikamente. In diesem Fall gehört auch dazu, die Patientin seelisch wieder zur Ruhe zu bringen. Es soll ein gesundes Verhältnis zwischen seelischem Erleben und Körper wiederhergestellt werden. Nachdem ich ihr alles erklärt und wir die verschiedenen Möglichkeiten ausgiebig besprochen haben, entscheiden wir gemeinsam, mit dem Antibiotikum erst noch abzuwarten und die Selbstregulation durch verschiedene Massnahmen zu fördern.
Wenig später meldet sich Herr Ludwig*. Er ist 78 Jahre alt und hat Schmerzen auf der Brust. Er ist nicht sehr geplagt und macht sich deutlich weniger Sorgen als seine Frau und Tochter, die offenbar die treibenden Kräfte sind, dass er sich überhaupt in unserem Walk-in vorgestellt hat. Der medizinischen Praxisassistentin, die Herrn Ludwig in Empfang nimmt, ist es aber sofort klar: Das ist kein Schmerz für den Walk-in-Bereich. Herr Ludwig wird auf den Notfall gebracht und am Monitor angeschlossen. Erfreulicherweise kann das dortige Team mit den notwendigen Untersuchungen wie Labor, EKG, Röntgen und Ultraschall akute gefährliche Ursachen für die Schmerzen letztlich ausschliessen. So kann Herr Ludwig ein paar Stunden später wieder nach Hause gehen. „Siehst Du“, raunt er seiner Frau gutmütig zu, „ich hab’s Dir doch gesagt, dass es nicht schlimm ist.“ Doch das lassen wir nicht ganz gelten: Wir konnten zwar einen akuten Herzinfarkt bei Herrn Ludwig ausschliessen, haben aber festgestellt, dass er ein beträchtliches Risiko für eine Herzerkrankung hat. Deshalb soll er sich unbedingt in der nächsten Woche bei seinem Hausarzt melden, um weitere Abklärungen zu planen. Wir informieren umgehend die entsprechende Hausarztpraxis. „Siehst Du“, zischt die Ehefrau von Herrn Ludwig etwas weniger gutmütig zurück.

Wenn kranke Menschen mit komplexeren Fragestellungen kommen, zeigt sich immer wieder der Vorteil, in einer Klinik zu arbeiten. Wir haben mittlerweile viele Spezialistinnen und Spezialisten, die man auch informell schnell um eine Meinung fragen kann, quasi „auf kurzem Weg“. Zudem verfügen wir über viele diagnostische Möglichkeiten, auch aus den verschiedenen Fachgebieten Neurologie, Gastroenterologie, Pneumologie, Schlafmedizin und Kardiologie. Wichtig ist uns aber, dass die „Spezialisten für das Ganze“, also die Hausärztin oder der Hausarzt, die Hoheit über die Behandlung und Diagnostik behalten, insofern Abklärungen nicht dringend sind. Man könnte auch sagen, die ärztliche Fachperson, die ihre Patientin und ihren Patienten am besten kennt, führt die Regie. Zusammenarbeit beschränkt sich aber nicht nur auf unser eigenes Haus. Im Walk-in und Notfall konsultieren wir oft das Spital Dornach für chirurgische Probleme. Auch arbeiten wir eng mit diversen anderen Spitälern der Region zusammen. Für welches wir uns im Einzelfall entscheiden, ist von der aktuellen Fragestellung und natürlich auch von der Präferenz der Patientinnen und Patienten abhängig.
Während Herr Ludwig noch auf dem Notfall überwacht wird, ruft die Sanität an. Sie sind zu Frau Meyer*, 76-jährig, gerufen worden. Der linke Mundwinkel hängt, und der linke Arm fühle sich „komisch“ an, seit sie am Morgen aufgewacht ist. Die Sanität ist sicher, dass es sich um einen Hirnschlag handelt, aber Frau Meyer will unbedingt zu uns in die Klinik kommen. Wir sprechen mit ihr am Telefon: Sie soll sich dringend ins Universitätsspital fahren lassen, nur ein Zentrumsspital verfügt über die technischen Voraussetzungen für eine adäquate Behandlung eines Hirnschlags. Zudem darf keine wertvolle Zeit verloren gehen. Je früher die notwendige Behandlung begonnen wird, desto besser ist die Prognose für die Patientin. Auch in dieser Situation zeigt sich, wie wichtig die Zusammenarbeit im regionalen Gesundheitsnetz ist. Nachdem ich ihr die Situation erklärt habe, ist Frau Meyer einverstanden und wird mit Blaulicht direkt nach Basel gefahren. Sie meldet sich zwei Wochen später von zu Hause aus. Im Universitätsspital Basel konnte eine sogenannte Lysetherapie gemacht werden, um das Blutgerinnsel im Hirn aufzulösen. Es ist erfreulicherweise alles gut gegangen, und sie kann wieder alles machen, ist aber „noch nicht ganz die Alte“. Wir verabreden, eine ergänzende aufbauende Therapie zu beginnen, unter anderem mit der Einnahme von Arnica. Zudem verordne ich ihr Heileurythmie.
Die 24-jährige Frau Weiss* hat ähnliche, auf eine Blasenentzündung deutende, Symptome wie Frau Klein*. Es sei nicht sehr schlimm, aber sie hat sich sofort gemeldet, da sie schon vor drei Monaten ähnliche Symptome hatte und sich dann eine Nierenbeckenentzündung der rechten Niere herausstellte. Der Urinbefund zeigt nur wenig Infektzellen, aber im Blut sind die Entzündungswerte überraschend hoch, und die Patientin hat Schmerzen in der rechten Flanke – also leider wieder eine beginnende Nierenbeckenentzündung. Nachdem Urin und Blut für Kulturen abgenommen wurden, bekommt Frau Weiss sofort eine erste Dosis Antibiotika direkt in die Vene. Wir behandeln gewisse Infekte mit natürlichen Mitteln. Wichtig ist uns, dass wir keine gefährlichen Situationen eingehen, weshalb wir uns hier für eine antibiotische Therapie entscheiden. Wir beginnen zusätzlich eine Behandlung mit Eukalyptus Ölauflagen, zudem bekommt sie das Kombinationspräparat Marum Comp. Am nächsten Tag kommt Frau Weiss erneut zu uns – für eine zweite Dosis Antibiotika. Es geht ihr zum Glück schon deutlich besser, aber die Nieren und die Blase müssen unbedingt weiter untersucht werden nach zwei so kurz aufeinanderfolgenden Infekten. Ein Ultraschall zeigt rechts eine sehr kleine Niere, ich überweise Frau Weiss an einen Urologen. Bei der Kontrolle nach zehntägiger Behandlung geht es Frau Weiss wieder sehr gut. Ich erkläre ihr sehr genau, was sie alles machen muss, um weitere Infekte möglichst zu verhindern. Und das muss sie, denn Nierenbeckenentzündungen sind gefährlich.
Herr Simon*, 56 Jahre alt, ruft an. Ihm ist schon länger so komisch, wenn er die Treppe hochläuft. Der Puls holpert unregelmässig, und heute gehe es ihm besonders schlecht. Ob er vorbeikommen müsse, will er wissen. Er hat eigentlich nicht so Lust, auf einen Notfall zu kommen, denn er möchte nicht „in die Abklärungsmühle“ geraten, aber sein Hausarzt ist heute nicht in der Praxis. Ich bestätige ihm: „Besser wir schauen, und ja, er soll doch kommen“. Im Walk-in wird klar, er hat ein sogenanntes Vorhofflimmern. Die Blutuntersuchung zeigt, dass er wahrscheinlich einen ganz kleinen Herzinfarkt hatte.

Er wird auf der Notfallstation aufgenommen. Die Kardiologin der Klinik macht eine ECHO-Untersuchung, das ist ein Ultraschall des Herzens. Sie tauscht sich mit der Kardiologin des Universitätsspitals Basel aus; beide kommen überein, dass ein koronares Angiogramm, eine Katheteruntersuchung der Herzkranzgefässe, jetzt nicht notwendig ist. Das wird mit Herrn Simon besprochen. Er wird am Monitor überwacht und bekommt einen Betablocker, der seinen Puls etwas verlangsamt. Wir machen Infusionen, unter anderem mit einem potenzierten Präparat aus Sarothamnus (Besenginster) und Stibium (Antimon) sowie einer Auflage in der Herzgegend mit einer Salbe aus Aurum, Lavendel und Rosenöl.
Am nächsten Tag geht es Herrn Simon deutlich besser. Ein bisschen „Mühle“ musste sein, aber er hat sie doch gut vertragen, da wir ständig mit ihm im Gespräch waren und er verstanden hat, worum es geht.
Es ist uns ein grosses Anliegen, Patientinnen und Patienten so im Abklärungsprozess mitzunehmen und zu involvieren, dass sie wirklich auch mündig mitentscheiden können.
Am Ende meines Arbeitstages meldet sich der 32-jährige Herr Riegger*. Sein linker Daumen ist in einen, schon sehr blutigen, Verband gewickelt. Er hat ihn beim Holzschnitzen erwischt und ärgert sich furchtbar. Die Wunde muss genäht werden. Es ist nicht kompliziert, aber ich muss mich sehr konzentrieren. Der Mann erzählt so interessant über verschiedene Hölzer und andere Aspekte seines Hobbys, dass ich die Wunde fast vergesse. Auch sein Ärger ist wieder verflogen ob seiner Begeisterung für das Handwerk.
Ich bin an diesem Abend, wie so oft, dankbar für das Vertrauen, das uns unsere Patientinnen und Patienten schenken. Je mehr Geschichten ich höre und kranke Menschen begleite, desto bescheidener werde ich. Bei solch mutigen Bewältigungsstrategien in teils schwierigen Lebenslagen kann ich manchmal nur staunend zuhören und lernen – und die Erfahrungen eines Menschen dann wieder einem anderen zugutekommen lassen. Unser ärztlicher Leiter, Lukas Schöb, drückt es so aus: „Wir Ärzte haben das Glück, den schönsten Beruf der Welt ausüben zu dürfen.“ So ist es!
*Name von der Redaktion geändert